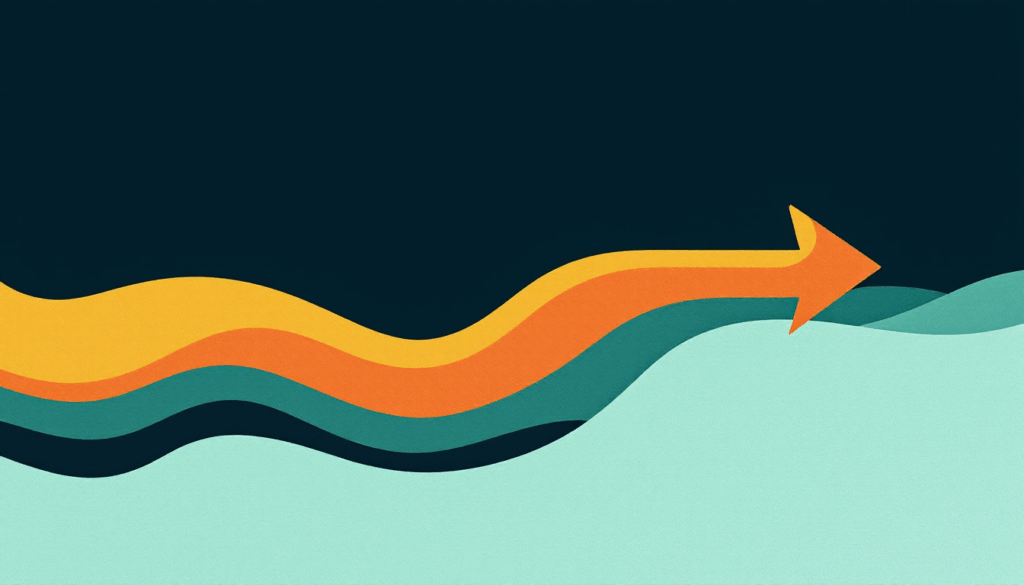
Frust als Ressource
Thema: Enttäuschung als Wendepunkt zum Change
Der Sommer 2025 war für viele von uns eine Zäsur. Zwischen erneuten Hitzerekorden, Rezessionsmeldungen und politischen Zwischenbilanzen war die Stimmung ambivalent. Und plötzlich war er da, der Frust.
Frust kennt jede Führungskraft. Er entsteht, wenn der eigene Einsatz nicht im erhofften Verhältnis zu den Ergebnissen steht, wenn Erwartungen enttäuscht werden oder wenn die Rahmenbedingungen ein erfolgreiches Vorankommen verhindern. Gerade nach einem Sommer, in dem die Konjunktur stagniert, Budgets eingefroren werden und sich die Auftragslage zäher gestaltet als erhofft, wirkt Frust wie ein lähmender Begleiter. Frust ist auch ein unbeliebtes Wort. Er klingt nach Stillstand, Resignation, nach Energieverlust. Doch genau hier lohnt der zweite Blick: Frust ist nicht nur Blockade, er ist auch ein Signal für notwendige Veränderung. Momente, in denen bestehende Gewohnheiten und Routinen ins Wanken geraten, können die Voraussetzung für echten Wandel schaffen.
Wissenschaft war soweit
In der Psychologie spricht man von „cognitive dissonance“ (Festinger 1957) und dem daraus in der neusten Managementliteratur weiter interpretierten „constructive discontent“, der produktiven Unzufriedenheit. Gemeint ist: Nur wenn ein Missstand emotional sichtbar wird, entsteht überhaupt die Kraft, etwas ändern zu wollen. Frust signalisiert, dass Status quo und Anspruch auseinander fallen und dieser „Missmatch“ ist der Treiber für Entwicklung. Nach dieser Sichtweise können aus dem Erkennen von Problemen kreative Chancen zur Verbesserung entstehen.
In der Transformationsforschung gilt Frust als Schwellenzustand. Kurt Lewin beschrieb bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die „Unfreezing“-Phase, in der alte Gewissheiten sich auflösen müssen, bevor Neues entstehen kann (Lewin 1947). Frust gehört genau hierhin: Er ist das unangenehme Gefühl, wenn vertraute Strukturen nicht mehr tragen und zugleich das Zeichen, dass Veränderung unausweichlich und möglich wird. Ohne ein Auftauen, also das Infrage stellen des Status quo, gibt es keinen echten Neuanfang.
Hartmut Rosas Resonanztheorie (Rosa 2016) erinnert schließlich daran: Nicht nur Freude, auch Reibung ist eine Form von Beziehung zur Welt. Resonanz bedeutet, dass wir von der Welt berührt werden, antworten und neue Lösungen ziehen. Frust kann gelesen werden als Widerstandserfahrung, die uns zwingt, neu zu antworten. Anstatt uns von der Welt abzukoppeln, hält uns Frust im Dialog: unbequem, aber energiegeladen und resonanzfähig.
Der Punkt ist also: Frust ist nicht das Ende, er ist der Anfang.
Neue Energie für die Führung
Für Führungskräfte stellt sich die Frage: Wie kann man Frust in Teams konstruktiv nutzen? Drei Impulse von mir, die die Theorie übersetzen und sich in der Praxis bewährt haben:
1. Frust sichtbar machen ohne Scham
Studien zeigen, dass unausgesprochene Unzufriedenheit die größte Bremse für Motivation ist. Wer Räume schafft, in denen Teams offen über Ärgernisse sprechen dürfen, schafft Entlastung und die Chance, Muster zu erkennen. Ein „Frust-Check-In“ zu Projektbeginn kann hier genauso hilfreich sein wie eine ehrliche Retrospektive nach Quartalsende. Nicht ein Kummerkasten irgendwo in der Ecke der Firma, nicht noch eine Zufriedenheitsumfrage. Ich schlage hier eine aktive Ansprache in Projekten vor.
2. Frust in Energie umwandeln durch klare Fokussierung
Frust entsteht oft, wenn Erwartungen und Realität auseinanderklaffen. Führungskräfte können helfen, indem sie Prioritäten neu sortieren und klare Ziele setzen. Hier lohnt sich das Prinzip „Säge schärfen“ (Covey 1989): Nicht hektisch weitermachen, stattdessen innehalten, sortieren, ausruhen und dann mit geschärften Werkzeugen starten. Eine reflektierte Entschleunigung vor dem nächsten Projektsprint.
3. Frust in Lernen transformieren durch kleine Experimente
Statt auf den „großen Wurf“ zu warten, können kleine Pilotprojekte Frust abbauen und Zuversicht erzeugen. Wenn ein Team mit entscheiden darf, wie es ein Problem kreativ angeht, wird Frust zur Quelle von Innovation. Führung heißt hier nicht, Frust sofort „wegzumachen“, sondern ihn als Herausforderung zu deuten, zu halten und gemeinsam in Handlung zu übersetzen. Bitte nicht mit Aktionismus verwechseln. Aber wir wissen ja alle, auch anfänglich kurze Laufdistanzen können die Lust auf Marathon steigern.
Nicht jedes Tief ist eine Krise
Ich schreibe das nicht nur aus der Theorie. Mein eigener Sommer war geprägt von dieser Ambivalenz: Freude im Privaten, Delle im Beruflichen. Es war ernüchternd, die Tage ohne Aufträge zu erleben, gerade, nachdem ich in epovia so viel investiert hatte. Für ein paar Tage hat mich das tatsächlich gelähmt.
Und dann habe ich mich gefragt: Wie kann ich meine eigene Säge schärfen?
- Ich habe meine Texte für den Wandel weitergeschrieben, die Sinntextur kreiert und damit Klarheit in meinem Kopf gebracht.
- Ich habe Gespräche geführt, in denen ich ehrlich sagen konnte: „Ja, ich bin gerade frustriert.“
- Ich habe die freie Zeit genutzt, um Impulse zu sammeln: in Büchern, in Workshops und Begegnungen, in der Natur.
Es war nicht die Flucht vor dem Frust, es war das bewusste Hineingehen. Heute sehe ich: Diese Phase hat mir Kraft gegeben, um wieder klarer zu sehen und die nächsten Schritte zu gehen.
Frust ist eine Ressource. Er zeigt uns, dass wir lebendig sind, dass uns etwas wichtig ist. Wer Frust ignoriert, verliert Energie. Wer ihn versteht und nutzt, gewinnt Zukunft. Für Organisationen bedeutet das: Nicht jedes Tief ist eine Krise. Manchmal ist es der notwendige Zwischenraum, in dem sich neue Klarheit bildet.
epovia. Wandel mit Sinn. Und manchmal auch mit Frust, als Anfang von etwas Neuem.